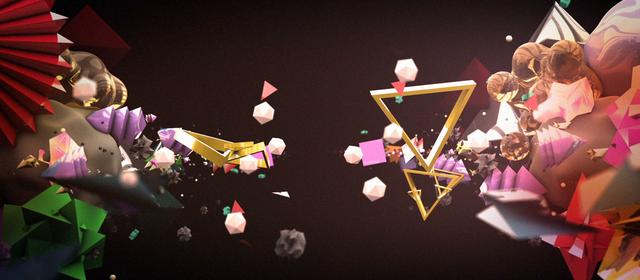Marc Schwegler von zweikommasieben trafen Rohlf während der 2013er Ausgabe zum Gespräch.
Marc Schwegler Kannst du uns einen kleinen Einblick in die Themenfindung und die Programmation geben?
Jan Rohlf Nun, weil wir hoffentlich wache Musikhörer sind, läuft nur schon damit etwas Zeitanalytisches in die Themenfindung. Weil wir ein jährliches Festival sind, gibt es dann halt einfach auch einen bestimmten Zeitpunkt, an dem wir ein Thema festlegen. Wir begreifen dieses Thema jedoch nie absolut: Es muss nicht jede Veranstaltung innerhalb des Festivals explizit reinpassen. Wir haben eigentlich eher die Idee, dass diese Themen über die Jahre einen Katalog von möglichen Perspektiven und Fragestellungen auf aktuelle Musikkultur ergeben. Diese verschiedenen Blickwinkel laufen ineinander: Das letztjährige Thema Spectral schwingt also auch noch im diesjährigen Golden Age mit – die einzelnen Themen bilden über die Jahre ein Geflecht. Aber die Kommunikationsgepflogenheiten bringen es halt mit sich, dass man versuchen muss, jedes Jahr alles relativ pointiert über einen Kamm zu scheren.
MS Sind diese Themen also eigentlich auch vor allem ein Verkaufsinstrument für Sponsoren, Medien und die Öffentlichkeit?
JR Vordergründig betrachtet ist es natürlich so, dass man sich an gewisse Konventionen halten muss, wenn man von bestimmten Einrichtungen Geld erhalten will. Popmusik und auch experimentellere Musikformen stehen ja generell immer unter dem Verdacht, dass es dabei eigentlich um kommerzielles Kulturgeschäft geht und das Ganze keine Tiefe hat. Generell finde ich, dass die hier angesprochenen Einrichtungen diesbezüglich nicht auf der Höhe der Wahrnehmung und des Diskurses sind. Man muss folglich immer einführend deutlich machen, dass es um viel mehr gehen kann als eben nur die neuste Band auf der Bühne. Von daher: Ja, wir nutzen diese Art des Kuratierens um mit der Kunstform Popmusik in der deutschen Förderlandschaft überhaupt Fuss fassen zu können, obwohl sie vielleicht eher aus einem anderen Kontext kommt. Das ist implizit auch eine Kritik am Zustand unserer Strukturen. Die sind nicht up-to-date bezüglich dessen was wir heute darüber wissen, wie die Musikszene funktioniert, welche Rolle Musik spielt und wie die verschiedenen Formen interagieren. Das ist alles gar nicht abgebildet in diesen Förderstrukturen. Das ist ein Grund.
Ein weiterer Grund ist, dass das Finden eines Fokus für uns jedes Jahr auch eine Herausforderung ist. Wir wollen damit unser Festival auf eine spannende Weise strukturieren und ihm eine Form geben, damit es nicht einfach ausufert. Wir fordern damit unser Publikum auf, eben nicht nur nach dem Kick der Konzerterfahrung oder den neusten Sounds oder anderen Intensitäten zu suchen, sondern vor- und nachgeschaltet auch andere Ebenen miteinzubeziehen.
MS Damit ist also gerade der Diskursteil der CTM nicht nur ein Feigenblatt für die Kulturförderung, sondern integraler Bestandteil des gesamten Festivals?
JR Genau. Der Diskursteil ist eigentlich ein Versuch, uns selber Klarheit darüber zu verschaffen, was wir im Moment an Musik erleben und was eigentlich gerade passiert. Es geht darum, über die Musik hinaus Themen zu besprechen. Diese Themen schwingen immer mit, auch wenn man sie nicht explizit ansprechen würde. Dem kann man sich gar nicht entziehen, es gibt kein Ausserhalb bei diesem Diskurs – nicht für mich.
Um ein Beispiel zu machen: Die Frage die wir dieses Jahr stellen ist, wie man mit diesem endlosen Strom von Variationen, mit dieser völlig ausufernden und entgrenzten Musik umgeht – das ist kein Phänomen, das sich nur auf die Musik beschränkt. Wir erleben das in allen kulturellen Bereichen. Die Musik ist nur eine Möglichkeit, sich dem Ganzen anzunähern. Wir haben deswegen auch Leute eingeladen, die gar nicht aus dem Musik-Bereich kommen, um dann gemeinsam darüber nachzudenken, ob Begriffe wie Kreativität oder Originalität heute überhaupt noch etwas taugen. Ist da noch neues Potential oder gibt es wirklich nur noch diesen Horror des auf-der-Stelle-Tretens und des sich-in-immer-kleineren-Variationen-weiter-Auszudifferenzierenden? Das sind sehr wichtige Fragen – die betreffen jeden. Musik ist da nur ein Feld, ein Weg, um sich dem zu stellen.
MS Wie wichtig ist da die Verbindung zur Transmedialen?
JR Die beiden Festivals sind verzahnt und verflochten – da gibt es eigentlich gar keine so klaren Identitäten und Abgrenzungen mehr. Die Idee, Musik in den Festival-Kontext derTransmediale zu pflanzen, das war am Anfang ein wichtiger Impuls. Damit entstand die Möglichkeit und auch die Aufforderung, alles zu verbinden: Diskurs, Kunst, Musik. Und damit eben auch die Akteure aus all diesen Feldern wirklich anzusprechen. Wir treten mit dem Anspruch an, elektronische beziehungsweise digitale Kultur in einer Gesamtschau zu zeigen und das ganze Spektrum abzubilden; und das eben nicht aus der Ferne, sondern immer auch aus einer Innensicht. Wir haben so viele verschiedene Kuratoren und Leute, die den beiden Festivals zutragen, dass eigentlich jeder Teil – ob das Filmprogramm bei der Transmediale oder unser Musikprogramm, unser Diskurs- oder deren Konferenzprogramm – von Leuten kommt, die sich in den entsprechenden Bereichen auch auskennen. Das ist total wichtig.
MS Der Overload des Golden Age macht sich auch im Programm bemerkbar: Es ist für Besucher schlicht unmöglich, alles zu sehen, was während des Festivals stattfindet. In eurem Programmheft beschreibt ihr die CTM auch als „gloriously overloaded festival“. Steckt also kuratorische Absicht in dieser Überfülle?
JR Genau. Natürlich könnte man sich das ideale Festival vorstellen, wo es überhaupt keine Überschneidungen gibt und alle Besucher immer schön von einer Sache zur nächsten geleitet werden und alle alles teilen und sich über alles unterhalten können. So eine Vorstellung hat natürlich auch etwas sehr Befriedigendes. Aber andererseits glaube ich – gerade wenn man mit diesen Spannungsfeldern arbeiten will, die wir ja auch mit dem Thema ansprechen – dass es wichtig ist, diese Spannungen am Festival spürbar zu machen. Dieses Zerrissen-Sein – „soll ich jetzt hier hin gehen oder da, ich möchte doch überall zugleich sein!“ – das ist doch genau die Situation, die wir alle auch im Alltag erleben. Es gibt viele Wege und es hat nicht jeder das gleiche Festival. Ich finde das sehr interessant… Was passiert dann eigentlich? Wie können die Menschen dann darüber sprechen, was sie erfahren und was sie erlebt haben? Dann ist das Festival eben nicht ein Schutzraum, wo alles schön sortiert wurde und man die ganze Kakophonie der Welt aussen vor lässt, sondern es bleibt ein gewisses Rauschen. Wir haben diese Strategie bereits von Anfang an verfolgt und in letzter Konsequenz auch befördert, was wir jetzt betreiben. Darum ist das Golden Age ein Thema, das uns auf uns selbst zurückführt. Wobei wir eben auch selber nicht wissen, ob wir mit den Konsequenzen glücklich sind oder nicht.
Aber eigentlich forderten doch alle künstlerischen Avantgarden und die ganze Popmusik genau diese Entgrenzung. Und wenn sie jetzt da ist, dann zeigt sich natürlich sofort – wie es eigentlich immer ist – dass solche Entwicklungen immer auch einen Rattenschwanz von Dingen mit sich ziehen, mit denen man dann wirklich Probleme hat. Und so ist es mit dem Festival: Wir haben immer gesagt, dass unsere Besucher verleitet werden sollen, im Grunde über ihre Ressourcen hinaus zu gehen – über ihre Zeitressourcen, über ihre physischen Ressourcen, über ihre Aufmerksamkeitsressourcen. Wir glauben, dass man dadurch in einen bestimmten, vorher noch nicht zu erahnenden Zustand kommt. Du weisst nicht genau, wie weit und wohin dieser dich trägt – das ist ein kleines Moment von Kontrollverlust, von Loslassen. Das ist etwas Schönes, das für einen Moment auch befreiend ist. Es ist zwar immer mit dem Risiko behaftet, dass einer angesichts der Überforderung dann auch dichtmacht und sagt „jetzt geh ich“ – aber was soll’s, das gehört auch dazu. Es führt dazu, dass man den Raum des Gewohnten und der eingeübten Dinge einmal verlässt… Das ist auch das, was man sucht, wenn man in einen Club geht. Das war immer das Eigentliche an der Cluberfahrung. Es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass wir früher Club Transmediale hiessen. Wir haben natürlich genau dieses Moment auch selber als etwas Spannendes, Begehrenswertes erlebt. Das leitet uns bis heute. Insofern haben wir uns auf keinen Fall von der Clubkultur abgewandt. Jene schwingt auch auf diesen Ebenen mit: Das Erlebnis muss nicht mal mehr im Club stattfinden, sondern kann genauso auch in der Festival-Textur funktionieren. Da gibt es diesen Wunsch, dass sich die Leute mit auf eine Reise begeben. Das ist für mich wesentlich für ein Festival, auch im eigentlich Sinne des Wortes: Wir reden immer von Festivalisierung, denken dabei aber in Kategorien von Event- und Citymarketing. Aber eigentlich ist ein Festival halt das Fest – der besondere Moment – in dem man den Anforderungen des Überleben-Müssens temporär eine Absage erteilt; man ist in dem Moment erst einmal davon befreit. Darum geht es eigentlich bei einem Festival.
MS Wir haben im Rahmen der diesjährigen CTM Terre Thaemlitz und Lee Gamble zum Gespräch getroffen. Könntest du ein paar Worte darüber verlieren, was für euch an den beiden Künstlern interessant ist?
JR Terre Thaemlitz ist einer der wenigen Künstler im Musikbereich, die es wirklich schaffen, die verschiedensten Ebenen zusammenzubringen: Politischer Aktivismus, kritische Analyse, Theorieproduktion und formale Exzellenz. Sein Projekt Soulnessless ist eine sehr pointierte Analyse dieser Entgrenzung im Golden Age, dieser Verflüssigung von Musik und er bildet damit auch einen kritischen Gegenpol im Festival. Natürlich nicht den einzigen – auch Mark Fisher gehört beispielsweise dazu. Diese Gespaltenheit war für uns wichtig, die wollten wir ansprechen.
Es gibt diese Spannung zwischen der unglaublichen Vielfalt an Tools, Möglichkeiten und Ressourcen, die dafür gesorgt haben, dass viele Hürden gefallen und wiederum neue Limitierungen entstanden sind, die man vordergründig nicht so leicht erkennen kann. Terre Thaemlitz ist da jemand, der ganz, ganz genau hinsieht und den Finger auch in die Wunde legt. Ich fand das Projekt Soullessness faszinierend, eine heroische Don Quixoterie, sich mit der Prämisse von nicht downloadbaren 16 Gigabyte den Anforderungen des Online-Musikmarktes widersetzen zu wollen. Nur schon darauf aufmerksam zu machen, dass der Kontrollverlust für Künstler auch ein Problem ist – für die Hörer vielleicht ebenso – und dass das ökonomisch natürlich wahnsinnige Konsequenzen mit sich zieht, das ist schon sehr wichtig. Wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob ich selber diesbezüglich zu 100% bei ihm bin. Wir versuchen schon auch ein bisschen herauszukommen aus dieser kritischen Sicht, die in den letzten Jahren gerade bezüglich des Internets sehr eminent geworden ist – obwohl wir da selber eigentlich total pessimistisch sind. Ich versuche immer einen Weg zu finden und dem auch etwas abzugewinnen – als Potential. Man weiss noch nicht wo das hinführt, aber in drei, vier Jahren ist dann vielleicht doch etwas passiert. Terre Thaemlitz ist vielleicht jemand, der dem dann eher eine klare Absage erteilt – er hat ein anderes Programm. Ich finde es wichtig, dass das dann im Rahmen des Festivals auch zur Sprache kam.
Was Lee Gamble angeht: Wir haben dieses Jahr diese Programmlinie namens The Death Of Rave – Rave Undead. Ein schönes Sprachspiel: Rave ist tot aber lebt als Zombie weiter. Lee Gamble ist aus dem Grund im Festival, weil er als einer von mehreren Künstlern, an die Themen und Ästhetik der Jungle- und Ravebewegung der Neunziger anschliesst. Diese Künstler waren selber als Protagonisten dabei und besuchen nun diese Zeit wieder, eignen sie sich wieder an, verändern sie. Das ist erst einmal einfach ein Phänomen, das jetzt kommt. Die frühen Neunziger werden jetzt als letztmögliches Revival wieder aufgeweckt – als die letzte Periode, in dem Musik ein derart vorwärtsdrängendes Moment hatte, mit sozialpolitischen Implikationen: Ein Spirit, ein gemeinsames Empfinden, bei dem sich Leute im Erlebnis synchronisierten und auch dachten, dass dies etwas bedeutet. Und wo eben auch drum herum versucht wurde, dieses Moment in Form von Theoriebildung einzufangen. Es gab Versuche, das zu verschalten: Sei das die CCRU in England oder QRT in Berlin. Und wir kucken auf diese Zeit im Kontrast zu dem zurück, wo wir uns jetzt befinden. Natürlich ist das damit auch eine andere Figur des Golden Age – das Golden Ageder Vergangenheit.
Zur Zeit gibt es einen Konsens: Spätestens seit dem Entstehen von Jungle in den Neunzigern läuft das Hardcore Continuum, spätestens da haben wir also eigentlich das Ende der Fahnenstange erreicht und sind am Ende der Geschichte angelangt. Es wurde alles gemacht und jetzt ist der Pool an Musikereignissen gefüllt, das Zeug wird nur noch retroaktiv verschnipselt und neu zusammengebaut. Es ist nur noch Arbeit an der Vergangenheit. Wenn man das auf den Begriff des Golden Age überträgt, heisst das dann: Ist dieses Zeitalter immer noch nur eine paradiesische Vorstellung, liegt das immer irgendwo in der Vergangenheit oder wartet als Utopie in der Zukunft; oder kann man nicht auch den Begriff anders fassen? Früher hätte man das Golden Age so konzipiert, dass alles erledigt ist, Harmonie herrscht und wir keine Entwicklung mehr brauchen: Ein Garten, wo alle alles haben. Das sind jedoch Paradiesvorstellungen aus einer anderen Zeit, die andere Bedürfnisse hatte. Heute klingt das doch eher nach einem durch subtile Disziplinarmassnahmen erzwungenen Frieden. Wir haben doch eher einen Wunsch nach Dynamik, nach Veränderung – da beisst sich unser Begehren dran fest und der Stillstand ist für uns der Horror. Erstmal geht es darum, sich damit zu konfrontieren – das ist ein interessanter Punkt – und sich dann zu überlegen, dass diese freigesetzte Wucherung existiert, wo die Dinge auf eine schwer zu durchschauende Art und Weise miteinander kommunizieren und man selbst als Akteur auch nur ein Element in dem Strom der Dinge ist. Ist das dann nicht im Sinne von Möglichkeiten und daraus entstehenden Potentialen eine Art Golden Age? Einfach kein befriedetes, friedliches, sondern eines, das knirscht, das permanent Dinge produziert, die wir eigentlich gar nicht haben wollen und die uns permanent über den Kopf wachsen. Es geht entsprechend also vielleicht um ein Loslassen der anthropozentrischen Perspektive der zwei Jahrhunderte.
Ich finde es spannend zu merken, dass sich das Ganze im Kern um die Frage dreht, ob wir uns noch was vorstellen können, das noch nicht da ist. Etwas, was in der Zukunft liegen könnte, auf das wir uns hinbewegen wollen. Und ich merke, dass da unterschiedliche Ideen kursieren. Jemand wie Terre Thaemlitz sagt wohl: Nein, wissen wir nicht, wollen wir nicht, hoffen wir auch nicht drauf – da sollte man auch keine Zeit drauf verschwenden, wir müssen jetzt schauen und die Dinge abstellen, die uns JETZT am meisten schmerzen. Doch das impliziert doch auch, dass man – sollte es einem gelingen – sich in einer neuen Zeit wiederfindet. Jemand wie Mark Fisher würde meinen: Wir müssen uns für die nächsten 15 Jahre organisieren. Und jemand wie ich findet wohl: Da gibt es nichts zu planen oder zu organisieren, es ist einfache die Wildnis im Moment, die macht und tut. Wir können eigentlich nur hoffen, dass durch unkontrollierte Prozesse Dinge in Gang kommen, an die wir dann wieder anknüpfen können.