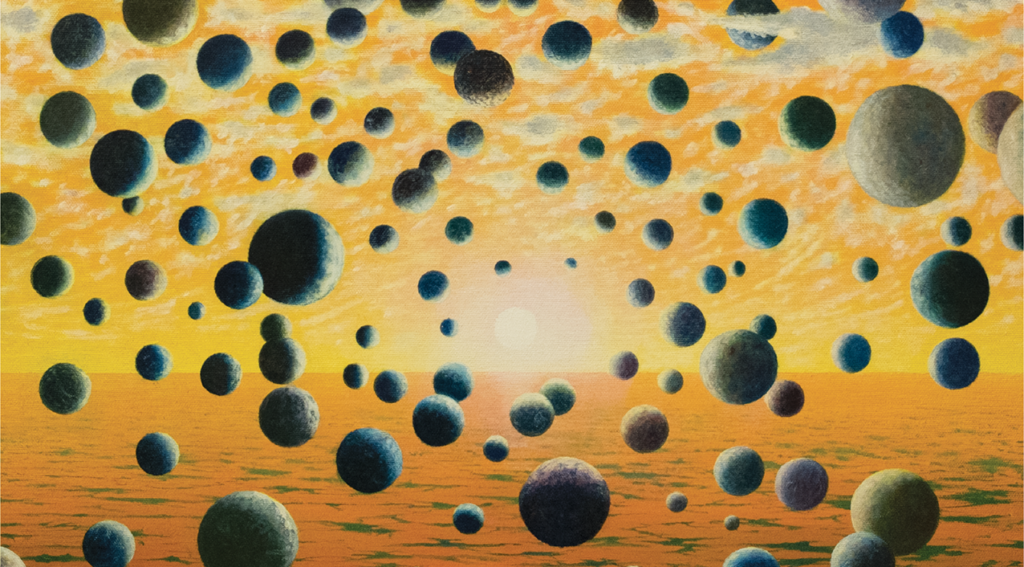Kunst und Musik, so fühlt es sich manchmal an, folgen einem ungeschriebenen Gesetz, das etwa wiefolgt beschrieben werden kann: Gute Arbeit folgt der Selbständigkeit und Selbstverwirklichung. Kreativität ist das Produkt einer Metamorphose, deren Endprodukt das Individuum ist, das wiederum einfacher vermarktet werden kann. Als soziale Wesen werden wir erst als beziehungsfähig angesehen, wenn das Selbst als geschlossenes System gebändigt wurde und wir unsere Abhängigkeit von emotionalen Stützen selbstentschlossen abgelegt haben. Ich selbst habe mich lange dem Ideal der emotionalen Selbstgenügensamkeit verschrieben. Die öffentlichen Ermutigungen zur Arbeit am Selbstbild à la Eat Pray Love, zum einen, und von Hollywood inspirierte Definitionen von Beziehungsmodellen, zum anderen, sorgen aber für Verwirrung darüber, wie man sein Schicksal «richtig» in Angriff nimmt.
Tatsache ist, dass die Energien anderer Menschen uns beeinflussen und uns berühren, wodurch sich ergibt, dass das, was wir als Selbst verstehen, ein unvollständiges Produkt ist, definiert durch den Bedarf nach äusseren Impulsen. Es kann sich riskant anfühlen, Abhängigkeit von anderen Menschen zuzugeben. Allerdings scheint genau diesem Geständnis in unserer Kultur immer mehr Platz eingeräumt zu werden. In einem Ende 2019 erschienen Artikel für das Fact Magazine hat sich etwa Jon Davies alias Kepla einer Häufung des Begriffs «interdependence» in Diskursen der Musikwelt gewidmet.[1] In ähnlicher Manier hat Mat Dryhurst [siehe zweikommasieben #13], der sich lautstark für die Kollektivierung digitaler Musiknetzwerke einsetzt, das unverhältnismässige öffentliche Pochen auf Unabhängigkeit und Selbstorientierung in der Musikbranche beschrieben. In einem Instagram-Beitrag mit dem Titel «Interdependent Music» eignet er sich eine Beobachtung des Charakters Manabu Horikita (aus dem Anime-Film Class of the Elite) an, um diesen Diskurs zu entlarven: «Wie üblich hast du Isolation mit Unabhängigkeit verwechselt». PROTO, Holly Herndons neustes Album bei dem Dryhurst beteiligt war, beruht hingegen auf einem Model gemeinschaftlichen und familiären musikalischen Schaffens.
In Precarious Life zeigt Judith Butler wie persönliche Verluste unsere grundlegende Verletzlichkeit und Abhängigkeit bzw. Interdependenz offenlegen: «Wir bestehen nicht nur aus unseren Verbindungen mit Anderen, sondern verlieren wegen ihnen den Anspruch auf den Besitz unseres Selbst…Wir müssen es akzeptieren: wir lösen uns gegenseitig auf. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir etwas vergessen…».[2] Ich erhalte täglich einen E-Mail-Newsletter zum Thema Selbsthilfe. Auch wenn ich oft an den Punkt komme, an dem ich ihn abbestellen will, finde ich unerwartet immer wieder ein Körnchen Weisheit im restlichen Schwulst. Der Titel des heutigen Newsletter lautet «Sich auf andere verlassen» und umschreibt in allgemein verständlichen Begriffen, was Butler im akademischen Register diskutiert: «Man benötigt Weisheit und Stärke, um sich seiner eigenen Hilflosigkeit auszuliefern und unsere eigenen Grenzen, die jeder andere Mensch auch hat, zu akzeptieren. Für diese Akzeptanz wird man reich belohnt: man entdeckt Bescheidenheit, Dankbarkeit und ein vertieftes Verständnis der Bedeutung, Mensch zu sein…»
Dieses Ausgeliefertsein und die Hingebung als Voraussetzung für Interdependenz können noch weitergedacht werden: Man kann seine Abhängigkeit nicht nur anderen Menschen gegenüber attestieren, sondern allgemein gegenüber der Welt oder einer mysteriösen höheren Gewalt. Das soziale Risiko eines solchen Zugeständnisses ist allerdings nochmals grösser.
Unterdessen tauchen Spiritualität und andere Spuren des Glaubens seit einiger Zeit in bestimmten Diskursen wieder auf, unter anderem in der Musik. Sich der Umwelt widmende «New Age»-Musik und Ambient erfreuen sich einer neuen Beliebtheit, vor allem unter dem mehrheitlich weissen Publikum für experimentelle Musik. Labels wie Music from Memory und RVNG haben Klassiker aus den 80er Jahren, zum Beispiel Suso Saizs Odisea und Pauline Anna Stroms Trans-Millenia Consort, in den letzten Jahren (2016 bzw. 2017) mit grossem Erfolg wiederveröffentlicht. Dieser Trend beinhaltet auch neue Musik, die sich teils ironisch, teils aufrichtig mit diesen Quellen auseinandersetzt. Es gibt immer mehr Konzertreihen für «transzendente»[3] Musik, die in Kirchen von Berlin bis New York, von Rio de Janeiro bis Zürich organisiert werden: Ellen Arkbro, Kali Malone [siehe zweikommasieben #19], Kara-Lis Coverdale [siehe zweikommasieben #21] und Sarah Davachi spielen alle auf alten Kirchenorgeln. Diese Bewegung findet vor dem Hintergrund einer noch breiter gefächerten Rückkehr zur Idee des Spirituellen statt, sei es unter dem Schlagwort «Self-Care», Yoga, Meditation oder Astrologie.
Ich habe mir zu diesen Entwicklungen in meiner eigenen Forschung zu Klimawandel sowie die Globalisierung und Digitalisierung bereits Gedanken gemacht. Dabei nahm ich auch auf einen den Verlust an Bedeutung Bezug, wie er ursprünglich zu Beginn des zwanzigsten Jahrhundert vom deutschen Soziologen Max Weber identifiziert wurde: «Je mehr der Intellektualismus den Glauben an die Magie zurückdrängt, und so die Vorgänge der Welt ‘entzaubert’ werden, ihrem magischen Sinngehalt verlieren, nur noch ‘sind’ und ‘geschehen’, aber nichts mehr ‘bedeuten’», schreibt Weber, «desto dringlicher erwächst die Forderung an die Welt und ‘Lebensführung’ je als Ganzes, dass sie bedeutungshaft und ‘sinnvoll’ geordnet seien».[4] Die Divergenz zwischen fehlender Bedeutung und im Übermass vorhandener Informationen motiviert, so scheint es, die Zuwendung zur Kunst, zu alternativer Spiritualität und anderen Formen der Gemeinschaft – auch zum Populismus (Trumps sei gerade in ländlichen Gegenden mit wenigen Gemeinschaftszentren und religiösen Anlaufstellen äusserst beliebt gewesen).
Die neuen musikalischen Ausdrucksformen des Spirituellen berufen sich auf Vagheit und Vielseitigkeit, genau wie die New Age-Bewegungen der 70er Jahre. Deren spirituelle Denkensweisen bedienten sich «unzähliger psychologischer, therapeutischer, magischer, sich am äussersten Rand der Wissenschaft befindenden und esoterischen Materialien», die sie neu verpackten und «zum individuellen Konsum und dem Ausleben eines privaten Synkretismus» anboten, so der Soziologe Thomas Luckmann.[5] Auf ähnliche Weise versteht Adam Possamai, ebenfalls ein Soziologe, diese New Age-Spiritualität als «Religionskonsum à la carte».[6] Eine solche Qualität birgt auch das aktuelle Revival von New Age-Musik, in der die Ästhetik religiöser und spiritueller Rituale aller Art aufgenommen und vermischt werden, ohne sich dabei auf einen spezifische Vorlage oder textlichen Inhalt zu berufen. Übrig bleibt eine Zusammensetzung atmosphärischer Räume und allgemein erkennbarer Symbole, die allerdings auf kryptische Bedeutungen hinweisen sollen. Der Klang dieser Musik an sich ist der einzige Signifikant, der sich aber einer klaren Interpretation entzieht: dem Publikum steht es frei, seine eigenen Meinungen zu bilden.
Diese Entwicklung erklärt, warum der Titel der NTS-Show der in Los Angeles lebenden Künstlerin Ana Roxanne – «Devotional Hour» – jeglicher kulturellen Brisanz entbehrt und einen Trend bedient. Eine solche Hingebung setzt allerdings ein Subjekt voraus. Wem widmet Roxanne ihre Zeit und Musik, und warum sollte wir als Publikum überhaupt in eine Kirche gehen wollen? Oder sind das die falschen Fragen?
Zuerst muss man klären, was Hingebung überhaupt bedeutet. Sich etwas hinzugeben heisst, etwas als besonders, auch im Sinne einer höheren Bedeutung, zu identifizieren und sich diesem dann zu verschreiben. Es steht in Verbindung mit der Idee freiwilliger Bescheidenheit, sogar der Selbstaufgabe, in der Konfrontation mit etwas Höherem und Grösserem. Der Akt der Hingabe ist theoretisch gesehen immer freiwillig und positiv. So kann Hingebung als die Hingabe einer Selbstüberwältigung verstanden werden; als das Versprechen, sich immer wieder aufs Neue verwundern zu lassen.
Der Musikologe Kofi Agawu schreibt, dass Musik zu spielen «die Inszenierung des Übergangs von einer gewöhnlichen in eine besondere Zone» ist.[7] Die Transformation des Gewöhnlichen in das Besondere, die Flucht aus der Sphäre des Alltäglichen, kann man im Sinne der Hingebung verstehen. Es handelt sich um eine Gabe an andere Menschen, an Kunst an sich, an das Leben. Es ist eine Sakralisierung. In einem Gespräch mit John Christopher Morten teilte der Musiker und Schauspieler eine Kindheitserinnerung mit mir: Am Morgen eines Weihnachtstags fand er die Geschenke des Weihnachtsmanns (vor allem Actionfiguren) ausgepackt und aufgetürmt in einer Art Installation. Als er verstand, dass hier nicht etwa der Weihnachtsmann am Werk war, sondern sein Vaters, war er überwältigt. Später würde er diesen Akt, das Auspacken und Arrangieren der Figuren durch seinen Vater, als Modell für seine eignen Performances verstehen lernen. Es war eine Erfahrung, die sein Bedürfnis, Musik zu machen und vorzuführen, entscheidend beeinflusst hat. Mir scheint dies eine wunderschöne Auffassung von Performance: Performance als kreatives Geben, als beständige Hingabe.
Im als besonders ausgewiesenen Raum der Musik oder des Theaters gibt es allerdings sich stark unterscheidende Ausrichtungen der Hingebung. Ein anonymes Zitat aus dem neunzehnten Jahrhundert ermahnt uns: «Die Energien, die kein menschliches Objekt der häuslichen Bewunderung finden, verwandeln sich in die andächtigen Energien der Welt.» Dieses Beschreibung erinnert mich an eine Anekdote aus der letzten Phase meiner musikalischen Ausbildung, als ich Gesang in einem Ensemble in der Schweiz studierte. Wir trafen uns einmal pro Monat in einer Gruppe von etwa zehn Leuten, um mittelalterliche und Renaissancemusik einzustudieren. Dieses frühe Repertoire gefiel mir, besonders seine Dramatik. Wir konzentrierten uns schlussendlich nur auf Madrigale (säkulare, polyphonische Stücke für mehrere Stimmen), die sich auf «menschliche Objekte der häuslichen Bewunderung» konzentrieren, zum Beispiel ein schönes Mädchen. Ich aber war darauf aus, diese Objekte genau nicht zu finden und sie mir andernorts suchen zu müssen. Ich wollte mich der Musik in einem höheren Sinne hingeben, auf einer existentiellen Ebene. Ich verliess daher den Ensembleunterricht, widmete mich meiner Musik und nahm meine musikalische Erziehung als Vorbild.
Ich wuchs in einem vielfältigen musikalischen Umfeld auf. Zuhause hörten wir alles von jazz bis zu Jock Jams und Bach-Kantaten. Ich bin ein Priesterkind, und wir gingen als Familie oft sonntags in die Kirche. Meine beiden jüngeren Geschwister sangen in einem Chor im anglikanischen Stil und hunderte von Leuten begleiteten die Hymnen in dem hochgewölbten Raum unserer Kirche mit ihren Stimmen, vorangetrieben von einer Orgel. Obwohl ich den Texten der Hymnen kaum folgte, diese Musik erzeugt eine Energie, die über das «Häusliche» hinausgeht. Es geht um grosse Gefühle, den ursprünglichen Rave. Organisierte Religion führte mich zu einem Model eines gemeinschaftlichen Rituals, das auf Selbstbestimmung beruht. In den Traditionen, die ich in meiner Kindheit kennenlernte, wurde Musik in einem grossen Rahmen inszeniert, um die Erfahrung überwältigender Gefühle zu ermöglichen und dadurch einer Gemeinschaft Rückhalt im Angesicht der Unsicherheit zu geben. In dieser Funktion wird Musik zu einem Rückzugsort, an dem Hingebung geübt und Katharsis erfahren kann werden. Musik übernimmt diese Funktion auch im Klubkontext, weshalb ich über die Jahre hinweg die Tanzfläche zu meinem Zuhause machen konnte.
Ana Roxanne wuchs in einem religiösen Haushalt auf, wie auch Alice Coltrane, eine der Mütter der ekstatischen Musik. Während ich nicht für diese Künstlerinnen sprechen kann, sehe ich meine eigene Praxis als Teil der langen Tradition dieser Musik, die Hingebung erfordert, ohne dessen Objekt festzulegen. Das Verlangen nach dieser Art von Musik ist die Hingabe – sie ist andächtig gegenüber den Traditionen der Menschen, die sich gemeinschaftlich dem Mysteriösen oder der Liebe – oder was auch immer es sein mag – hingeben. Auf dem Altar der Ambient Kirche befindet sich keine religiöse Reliquie, sondern die andächtigen Performer. Der Akt der Hingebung lässt dabei die Musik und die Menschen hinter sich und wird letzten Endes ein selbstbezogenes Ganzes, zeitlos in seiner Erinnerung an das Gefühl der kindlichen Überwältigung.
Die in New York lebende Musikerin und Musikwissenschaftlerin Annie Garlid veröffentlichte 2019 Ihr Debutalbum United auf Subtext unter dem Alias UCC Harlo. Soeben erschien auch ein Remix von Ihr, nämlich „Hibernation (UCC Harlo Remix)“ von Know V.A. Weitere Informationen zu Garlid findet man auf Ihrer Website: https://www.anniegarlid.com/
Der vorliegende Essay erschien ursprünglich in zweikommasieben #21 und das Magazin kann via Präsens Editionen bestellt werden: https://praesenseditionen.ch/
[1] Davies, Jon. «Interdependence, or How I Learned to Love Again on the Dancefloor». FACT, 20. December 2019, https://www.factmag.com/2019/12/20/interdependence-or-how-i-learned-to-love-again-on-the-dancefloor/, heruntergeladen am 26. Februar 2020.
[2] Butler, Judith. Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence. London, Verso, 2006, S.23-24, eigene Übersetzung.
[3] Der Begriff stammt von der Website der in New York stattfindenden Ambient Church Konzertreihe. https://ambient.church/, heruntergeladen am 26. Februar 2020.
[4] Weber, Max. Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen, J.C.B. Mohr, 1922. S.290
[5] Luckmann, Thomas. «The Privatisation of Religion and Morality». Edited by Paul Heelas, Scott Lash, and Paul Morris, Detraditionalisation: Critical Reflections on Authority and Identity. Oxford, Blackwell, 1996, S.72–86, eigene Übersetzung.
[6] Possamai, Adam. «Alternative Spiritualities and the Cultural Logic of Late Capitalism». Culture and Religion, 4 (1), 2003, 31–45.
[7] Agawu, Kofi. The African Imagination in Music. Oxford University Press, 2016, S. 29, eigene Übersetzung.